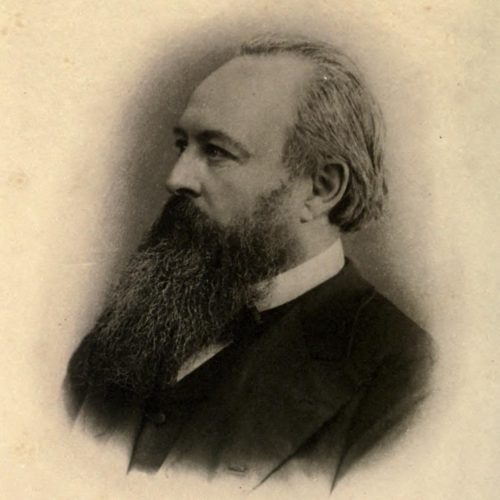Rawls, John

Von Will Wilkinson mit freundlicher Genehmigung von libertarianism.org
John Rawls (1921-2002) war der vielleicht prominenteste und einflussreichste amerikanische politische Philosoph des 20. Jahrhunderts. Rawls ist vor allem für sein 1971 entstandenes Werk A Theory of Justice bekannt, das für die Institutionen des modernen liberal-demokratischen Wohlfahrtsstaates und gegen den egalitären Sozialismus auf der einen Seite und den Klassischen Liberalismus auf der anderen Seite argumentiert.
Nachdem er eine Zeit lang an der Cornell University und dem Massachusetts Institute of Technology gelehrt hatte, trat Rawls 1962 in die philosophische Fakultät der Harvard University ein und blieb dort für den Rest seiner langen Karriere. In den 1950er Jahren verzichtete Rawls auf eine einfache Analyse der damals bei Philosophen beliebten Moralvorstellungen, und versuchte stattdessen, ein allgemeines Verfahren für die moralische Entscheidungsfindung nach kantischem Vorbild zu beschreiben. Seine Arbeit wurde auch durch zeitgenössische Schriften in der Theorie der Rational Choice beeinflusst. Von den späten 1950er bis Ende der 1960er Jahre veröffentlichte Rawls eine Reihe von einflussreichen Essays, die die Grundlage für sein berühmtestes Werk, A Theory of Justice, bilden sollten.
Eine Theorie der Gerechtigkeit erklärt, dass Gerechtigkeit die „erste Tugend sozialer Institutionen“ ist, und versucht, jene Prinzipien der sozialen Organisation zu identifizieren, die eine „realistische Utopie“ schaffen, in der der Einzelne frei ist, seine Ziele so zu verfolgen, wie er es wünscht, nur mit Einschränkungen, die jeder akzeptieren muss. Der zentrale Gegenstand einer Theorie der Gerechtigkeit ist laut Rawls die „Grundstruktur“ einer Gesellschaft – das System der miteinander verbundenen rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Institutionen, das den Bürgern ihre Grundrechte und -pflichten zuweist und die Bedingungen der sozialen Kooperation und die daraus resultierende Verteilung von Chancen und wirtschaftlichen Beteiligungen bestimmt.
Rawls‘ Auffassung von Gerechtigkeit, die er „Gerechtigkeit als Fairness“ nannte, besteht aus zwei miteinander verbundenen Gerechtigkeitsprinzipien. Das „erste Prinzip“, das dazu bestimmt ist, der demokratischen Regierung verfassungsmäßige Grenzen zu setzen, ist im Wesentlichen eine Neufassung der Prinzipien der ‚equal liberty‘ von J. S. Mill und Herbert Spencer, die besagen, dass „jede Person ein gleiches Recht auf die umfassendsten Freiheiten hat, die mit ähnlichen Freiheiten für alle vereinbar sind.“ Entscheidend ist jedoch, dass die Freiheiten, die Rawls im Sinn hat, nicht diejenigen umfassen, die sich auf Eigentum und Vertrag beziehen. Das „zweite Prinzip“, das den „Wert“ der von ihm vertretenen Grundfreiheiten garantieren soll, betrifft die Verteilung der Chancen: Reichtum, die „sozialen Grundlagen der Selbstachtung“ und andere soziale Vorteile. Er teilt dieses Prinzip in zwei Teile. Der erste Teil, das so genannte „Unterschiedsprinzip“ („difference principle“), verlangt, dass „soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten den am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bieten.“ Der zweite Teil verlangt, dass soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten „mit Ämtern und Positionen verbunden sind, die allen gemäß fairer Chancengleichheit offenstehen.“ Nach Rawls ist das erste Prinzip „lexikalisch vor“ dem zweiten, da Ungleichheiten in Bezug auf Chancen und Ergebnisse erst dann angegangen werden können, wenn ein maximal umfassendes System gleicher Freiheiten etabliert ist, und dass die „Neuordnung“ dieser Ungleichheiten innerhalb der Grenzen des Systems der Freiheit erfolgen muss.
Rawls versucht, seine Idee von „Gerechtigkeit als Fairness“ zu rechtfertigen und konkurrierende Alternativen auszuschließen, indem er sich auf eine Art „Sozialvertrag“-Gedankenexperiment in der Tradition von Hobbes, Locke und Rousseau beruft. Im Gegensatz zu den neo-Hobbesschen Modellen rationaler Handlungsweise, die in ökonomischen Standardmodellen verankert sind, stellt Rawls, stark beeinflusst von der Moralphilosophie Immanuel Kants, Menschen jedoch als ausgesprochen moralische Akteure dar, die über einen „Gerechtigkeitssinn“ oder eine „moralische Fähigkeit“ verfügen, die sowohl moralische Urteile als auch die Motivation zum Handeln nach moralischen Regeln liefert, auch wenn dies das Aufgeben eines engen Eigeninteresse-Verständnisses bedeutet. Menschen werden als rational im Sinne des Ökonomen, aber auch als „vernünftig“ verstanden. Rawls‘ Gedankenexperiment einer Wahl im „Urzustand“ („original position“) soll modellieren, wie unser Gerechtigkeitssinn die rationale Maximierung mäßigt. Im Urzustand sind Agenten als Maximierer von „Grundgütern“ („primary goods“) konzipiert, die für die Erreichung fast aller Ziele notwendig sind. Aber die Agenten sind auch so konzipiert, dass sie ihre Kooperationsbedingungen hinter einem „Schleier des Nichtwissens“ („veil of ignorance“) bezüglich ihrer Talente, Möglichkeiten, Klasse, sozialen Verbindungen usw. wählen, der dazu bestimmt ist, die Unparteilichkeit und Fairness vernünftiger moralischer Wesen zu modellieren.
Rawls argumentiert, dass seine beiden Prinzipien der Gerechtigkeit das sind, was Agenten – so idealisiert – in der „original position“ wählen würden. Innerhalb von Rawls‘ umfassenderem Argument stellt dies jedoch nur eine vorläufige Rechtfertigung für seinen Begriff von „Gerechtigkeit als Fairness“ dar. Die Gerechtigkeitsgrundsätze müssen sich ebenfalls als stabil erweisen, und Stabilität erfordert, dass echte Menschen sie unter realistischen Bedingungen bestätigen und einhalten können. Die Prinzipien der Gerechtigkeit müssen sich aus zwei Gründen im „reflektierten Gleichgewicht“ mit unseren „wohlüberlegten moralischen Urteilen“ (d.h. dem Resultat des Gerechtigkeitssinns nach Deliberation) befinden. Erstens, wenn vorgeschlagene Gerechtigkeitsprinzipien mit den moralischen Urteilen von Individuen kollidieren, werden wir nicht geneigt sein, sie oder eine Theorie, die sie vorschlägt, zu akzeptieren. Wenn wir sie nicht akzeptieren, werden wir nicht bereitwillig auf sie eingehen, und deshalb werden sie nicht in der Lage sein, unser Verhalten zu steuern und den Charakter der Gesellschaftsordnung zu bestimmen. Die Prinzipien einer gerechten Gesellschaft müssen sich selbst verstärkend sein. Infolgedessen argumentiert Rawls im letzten Drittel seiner A Theory of Justice dass der Einzelne, der in einer von „Gerechtigkeit als Fairness“ geordneten Gesellschaft aufgewachsen ist, eine persönliche Vorstellung vom Guten entwickelt, die mit den Anforderungen der Gerechtigkeit übereinstimmt.
In seinem zweiten großen Werk, dem 1993 erschienenen Political Liberalism, räumte Rawls ein, dass sein vorrangiges Argument für die Stabilität von „Gerechtigkeit als Fairness“ auf der Annahme beruhte, dass wir alle in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die unter einem einzigen, schwer kantischen „Gesamtkonzept“ von moralischer Menschlichkeit und dem Guten vereint ist. Diese Einheit, so argumentiert er, könne nur durch Zwang aufrechterhalten werden und sei unvereinbar mit der unendlichen Vielfalt der moralischen Anschauungen, die für eine freie Gesellschaft charakteristisch seien. Political Liberalism versucht also, „Gerechtigkeit als Fairness“ als eine relativ neutrale „politische“ Doktrin zu reformieren, die auf keiner einzigen metaphysischen oder moralischen Sichtweise beruht, sondern vielmehr als Inhalt eines „überlappenden Konsenses“ vieler konkurrierender „vernünftiger“ umfassender moralischer Ansichten konstruiert werden kann. So kann es mit „der Tatsache eines sinnvollen Pluralismus“ in Einklang gebracht werden. Rawls‘ letztes großes Werk, The Law of Peoples, versucht eine Theorie der internationalen Beziehungen, in der er sich Gegensatz zu einigen seiner Anhänger entscheidet, den Begriff „Gerechtigkeit als Fairness“ nicht weltweit anzuwenden.
Rawls‘ Werk ist bemerkenswert, da es die anglo-amerikanische politische Philosophie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominiert hat und indem es zum Teil andere Werke wie Robert Nozicks Anarchy, State, and Utopia inspirierte, das weitgehend als Antwort auf Eine Theorie der Gerechtigkeit geschrieben wurde. Nozick argumentierte, dass das Unterschiedsprinzip von Rawls ein ständiges, invasives Eingreifen der Regierung in freiwillige Aktivitäten erfordern würde, um das vorgeschriebene Verteilungsmuster aufrechtzuerhalten, wodurch die Priorität der Freiheit in Rawls‘ eigenem Schema beeinträchtigt würde. Rawls‘ Herabwürdigung der wirtschaftlichen Freiheiten und seine Verteidigung der Umverteilung haben eine Reihe kritischer Analysen libertärer und klassisch liberaler Denker inspiriert. F. A. Hayek und James M. Buchanan, wie Nozick, kritisierten scharf die zentrale Rolle von Verteilungsgerechtigkeit in Rawls‘ Gerechtigkeitsverständnis. Sowohl Hayek als auch Buchanan unterstützten jedoch Rawls‘ allgemeinen methodischen Rahmen und argumentierten, dass er klassische liberale Schlussfolgerungen generiert, wenn er mit einem angemessenen Verständnis der Prinzipien der politischen Ökonomie verbunden wird
Weiterführende Literatur
Buchanan, James M. Why I, Too, Am Not a Conservative: The Normative Vision of Classical Liberalism. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2005.
Epstein, Richard A. “Rawls Remembered.” National Review Online,http://www.nationalreview.com/comment/commentepstein112702.asp.
Hayek, Friedrich A. Law, Legislation, and Liberty: Volume 2. The Mirage of Social Justice. Chicago: University of Chicago Press, 1976. 100.
(Deutsch: Recht, Gesetz und Freiheit: Teil 2. Das Trugbild sozialer Gerechtigkeit. Tübingen: Mohr Siebeck, 2003.
Lomasky, Loren. “Libertarianism at Twin Harvard.” Social Philosophy and Policy 22 no. 1 (Winter 2005): 178–199.
Nozick, Robert. Anarchy, State, and Utopia. New York: Free Press, 1976.
Rawls, John. The Law of Peoples. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
(Deutsch: Das Recht der Völker. Berlin, New York: de Gruyter, 2002.)
———. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993.
(Deutsch: Politischer Liberalismus Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003.)
———. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
(Deutsch: Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.)