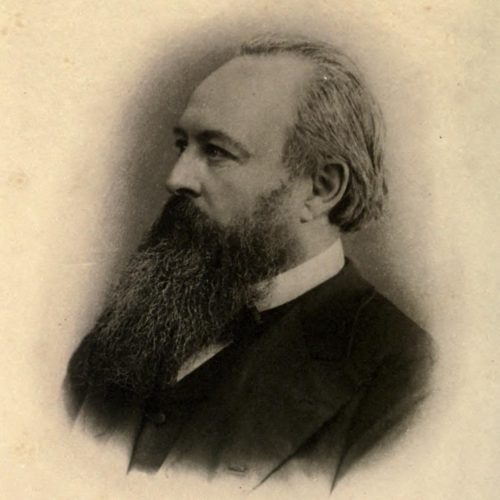Gleichheit

Von Dagmar Schulze-Heuling
Gleichheit ist für viele Menschen ein Ideal. Spätestens seit der Französischen Revolution ist Gleichheit aber auch ein politischer Slogan. Umkämpft und aufgeladen und darüber hinaus mit verschiedenen Inhalten belegt, ist eine Diskussion über Gleichheit oft schwierig. Hilfreich kann es sein, verschiedene Begriffsebenen zu unterscheiden.
In der allgemeinsten Form bezeichnet Gleichheit eine Relation zwischen Identität und Ähnlichkeit, bei der keine nennenswerten Unterschiede zwischen verglichenen Objekten festgestellt werden können. Sich gleichen wie ein Ei dem anderen, oder 1+1=2 sind Ausdrücke, die sich auf Gleichheit in diesem Sinne beziehen. Ganz offensichtlich ist hier aber keine moralische Qualität gemeint. Es wäre ein Kategorienfehler, eine Gleichung für gut und eine Ungleichung für schlecht zu halten, oder ein unifarbenes Outfit grundsätzlich für besser zu halten als kontrastierende Kleidungsstücke.
Anders verhält es sich mit der politischen Gleichheit. Damit ist üblicherweise gemeint, dass jeder Mensch in politisch-rechtlicher Hinsicht gleich viel zählt. Diesem Ideal ist nicht nur das Wahlrecht verpflichtet. Es zeichnet den liberalen Rechtsstaat aus, dass die Gleichheit aller vor dem Gesetz die Norm ist. Jede Ungleichbehandlung bedarf einer sachlichen Rechtfertigung.
Politische Gleichheit ist moralisch aufgeladen, sie ist aber weitgehend unumstritten. Die Vorstellung, einer Bevölkerungsgruppe aus sexistischen oder rassistischen Gründen das Wahlrecht zu verweigern, klingt für heutige Ohren absurd. Jeder Mensch darf sich politisch äußern und engagieren. Auch die Tatsache, dass dieses Recht nicht schrankenlos ausgeübt werden darf, ist allgemein akzeptiert. So ist Terrorismus kein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung, und ein Vorschlag, dass die gesamte Weltbevölkerung bei den luxemburgischen Parlamentswahlen wahlberechtigt sein sollte, würde wohl als Scherz verstanden werden. Dissens herrscht eher bei Detailfragen, etwa woran eine Wahlberechtigung geknüpft werden sollte oder ob es eine staatliche Verpflichtung gibt, Menschen bei ihrem politischen Engagement zu unterstützen.
Deutlich umstrittener ist die soziale Gleichheit. Hier ist weder klar, ob sie überhaupt erstrebenswert ist, noch, was damit gemeint sein soll. Geht es um Chancengleichheit oder um Ergebnisgleichheit? In welcher Hinsicht soll Gleichheit erzielt werden: bei der Ausbildung, bei den Einkommen, oder bei der Lebensqualität? Muss eine Gesellschaft jene Individuen, die so gelangweilt sind, dass sie keinen Gefallen an üblicher Nahrung oder verbreiteten Hobbies finden, subventionieren? Das fragt etwa die Philosophin Elizabeth Anderson. Ist eine Gesellschaft verpflichtet, einem Menschen zu helfen, das Beste aus sich zu machen? Wie ließe sich das definieren und identifizieren? Und müsste man die Menschen nicht auch zu ihrem Glück zwingen?
Insbesondere die letzte Frage deutet an, dass Gleichheit sehr schnell mit anderen Werten kollidiert. Während eine moderate Besteuerung zur Finanzierung z. B. von Sozialleistungen in Deutschland weitgehend akzeptiert ist, sind andere Freiheitseinschränkungen umstrittener. Je stärker der Egalitarismus ausgeprägt ist, desto weniger kann er Rücksicht auf den Datenschutz nehmen. Schließlich müssen die auszugleichenden Lebensumstände genau identifiziert werden. Neben Einkommen und Vermögen betrifft das auch den Bildungsstand, Gesundheitsdaten oder die subjektive Lebenszufriedenheit.
Ein anderes Beispiel ist die rigide Schulpflicht in Deutschland. Ironischerweise ist sie aber nicht nur eine Einschränkung von Freiheit, sondern produziert eine neue Ungleichheit. Denn nicht alle Kinder kommen mit dem angebotenen System gleich gut zurecht. Lerntypen, die im Standard-Schulunterricht nicht angesprochen werden, oder Kinder, die eine schlechte Lehrkraft erwischt haben, haben doppelt Pech. Nicht nur sind die (künstlich geschaffenen) Umstände für sie deutlich schlechter als für andere Kinder, es gibt auch kaum Möglichkeiten, die Situation im Sinne der Kinder zu verbessern.
Theoretische Unstimmigkeiten sowie praktische Probleme führen dazu, dass immer mehr in Frage gestellt wird, ob Gleichheit überhaupt einen moralischen Wert hat. Ein gewichtiges Argument in dieser Debatte ist die Entdeckung, dass die verbreitete Wertschätzung für Gleichheit auf einem Denkfehler beruht. Dieser Denkfehler besteht in der Verwechslung von absoluten Werten – z. B. Überleben, Wohlergehen, medizinischer Versorgung, Bildung, etc. – und relativen Werten, also Gleichheit. Wenn es nur um Gleichheit geht, dann wäre diese Bedingung durch eine gleich schlechte Behandlung bzw. ein gleich schlechtes Ergebnis erfüllt. Bei einem Schiffsunglück wäre das Kriterium der Gleichheit auch erfüllt, wenn alle an Bord befindlichen Personen ertrinken. Bei einer Hungersnot bestünde Gleichheit darin, dass niemand etwas zu essen bekommt und alle verhungern.
Wenn man die theoretischen Implikationen von Gleichheit ernst nimmt, wird es sogar noch schlimmer. Sollte es etwa gelingen, einige Schiffbrüchige oder Hungernde zu retten, dann wäre das ein Verstoß gegen die Gleichheit. Sofern man also nicht alle retten kann, kommt die egalitaristische Philosophie zu dem Ergebnis, dass man alle sterben lassen muss. Glücklicherweise hält kaum ein Mensch diese Konsequenz für ein moralisches Gebot. Dieses Gedankenspiel zeigt aber auf, dass Gleichheit schwerlich ein moralisches Ideal sein kann.
Statt sich an der Angleichung von Lebensverhältnissen abzuarbeiten, wäre gerade den Schwächsten und Bedürftigsten besser geholfen, wenn absolute Probleme – Unterernährung, Krankheit, Armut, Analphabetismus etc. – stärker im Fokus der Debatte stünden. Fraglos ist es zunächst irritierend, nicht die Unterschiede zwischen einem sehr armen und einem sehr reichen Menschen für die problematische Situation des ersteren verantwortlich zu machen. Doch das Problem besteht nicht in der Ungleichheit, sondern in der Armut. (Das Gedankenspiel, ob wir auch eine Millionärin bedauern würden, weil sie so viel weniger Geld hat als eine Milliardärin, verdeutlicht das.)
Diesen Sachverhalt zu erkennen, ist auch für praktische Politik wichtig. Ohne eine korrekte Diagnose ist eine erfolgreiche Behandlung unwahrscheinlich. Vielmehr besteht die Gefahr, Ressourcen für Scheinlösungen – die Veränderung von Relationen – zu verschwenden, die unter Umständen sogar mehr schaden als nutzen. Nicht nur, aber auch aus gerechtigkeitstheoretischer Perspektive ist es demgegenüber wünschenswert, sich auf die Behebung absoluter Missstände wie Armut oder Analphabetismus zu konzentrieren.
Literatur
Angelika Krebs: Gleichheit oder Gerechtigkeit. Frankfurt 2000.