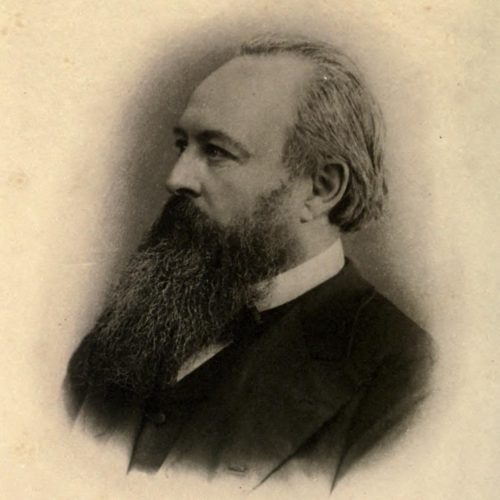Kant, Immanuel

Von Maximilian Priebe
Immanuel Kant wird oft als der einflussreichste Philosoph der Neuzeit bezeichnet. Diese herausragende Stellung bezieht sich allerdings nicht nur auf einen Kontext der politischen Theorie. Was Kants Philosophie besonders macht, ist, dass sie nahezu alle Bereiche des modernen Denkens berührt. Das wird bereits an der Spannweite von Kants Publikationen sichtbar. Im Unterschied zu vielen anderen Denkern, die sich bereits zu Ende des 18. Jahrhunderts auf einzelne „Fachbereiche“ spezialisiert hatten, reicht das Werk Kants von Themen der Mathematik, Logik, Physik, und Naturwissenschaft über die theoretische Philosophie hin zu Fragestellungen der Theologie, der Ethik, des Völkerrechts, der Anthropologie und der Geschichte. Dabei interessierten Kant oft die gleichen Fragen. Auf welcher Grundlage entsteht sicheres Wissen? Wo hört dieses Wissen auf? Nach welchen Grundsätzen soll ich handeln? Muss ich an Dinge glauben, die ich nicht weiß? Und was ist die Natur des Menschen?
Das hat zwei Effekte. Zum ersten ist Kant ein Systemdenker. Kants Antworten auf die oben genannten Fragen sind in seinen einzelnen Schriften, wenn sie separat gelesen werden, nur schwer verständlich. Stattdessen sind sie in ihrem Gesamtzusammenhang in ein mehr oder weniger kohärentes Lehrgebäude geflossen. Dieses System wurde von Kant und seinen Zeitgenossen je nach Publikationsstand und Epoche unterschiedlich betitelt, mal als transscendenteller, mal als transzendentaler Idealismus, als Transzendentalphilosophie, als Kritische Philosophie oder, wenn von ihr in einem Kontext mit Fichte, Schelling und Hegel die Rede war, auch als Deutscher Idealismus. Ein großer Teil der Kant-Forschung besteht darin, zu beurteilen, wie sich die einzelnen Teile dieses Lehrgebäudes zueinander verhalten und inwieweit das Kantische System die obigen Fragen tatsächlich beantwortet.
Zum zweiten hat Kant gerade durch diese systematische Philosophie eine besondere Grundlagenposition. Er hat nicht nur spezifische Problemstellungen und Lösungsvorschläge aufgeworfen, sondern, um die oben genannten Fragen zu beantworten, eine grundsätzlich neue Art des Denkens entwickelt. Diese neue Denkweise hat nicht nur der nachfolgenden Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts eine neue Perspektive und neue Prioritäten gegeben, sondern auch dazu geführt, dass sich viele Wissenschaften erst entwickeln konnten – unter anderem die Psychologie. Sie hat aber auch höchst unterschiedliche politische Strömungen beeinflusst. Das führt zu der nahezu paradoxen Situation, dass es heutzutage fast keine politischen Theoretiker gibt, die nicht in irgendeiner Weise Anspruch auf das „Kantische Erbe“ erheben. Diese Stellung als allgemeiner Referenzpunkt teilt Kant mit seiner Epoche, der Aufklärung. So leiten von der Frankfurter Schule beeinflusste SozialphilosophInnen wie Rahel Jäggi, Axel Honneth oder Christoph Menke von Kant einen aufklärerischen Emanzipationsanspruch, Minderheitenrechte und Sozialkritik ab, während gleichzeitig nationalistische Theoretiker in dem „großen Philosophen aus Königsberg“ ein Paradebeispiel preußischer Pflichterfüllung ausmachen können – und der Kategorische Imperativ auch schon mal für eine Rechtfertigung des Holocaustes vereinnahmt wurde.
Ich möchte ausgehend von dieser Beobachtung die Leitfrage stellen, was wir heutzutage überhaupt als Kantisches Erbe begreifen können, und zu welchem Teil dieses Erbe Teil der liberalen Denktradition ist. Oder, anders formuliert: Ist das Kantische Denken genuin liberal – und wenn ja, warum?
Leben, Lehr- und Schreibtätigkeit
Kant wurde 1724 in Königsberg geboren. Er hat die Region Ostpreußen nie verlassen. Die Eltern Kants waren Pietisten, gehörten also einer Strömung des Protestantismus an, die sehr starken Werk auf Innerlichkeit, Selbstbeobachtung, Bibelstudium und Frömmigkeit legte. Es wird immer wieder debattiert, inwieweit Kants Philosophie, die einen starken Fokus auf die Selbstbestimmung und Persönlichkeitsentfaltung, aber auch auf die Selbstdisziplinierung des Subjekts setzt, selbst vom Pietismus beeinflusst ist. Die Spätphase des Pietismus, die Individualität und Sentimentalität stark beförderte, fällt jedenfalls mit der Hochphase des deutschen Idealismus von 1780 bis 1820 zusammen. Viele deutsche Intellektuelle hatten Verbindungen zur pietistischen Bewegung, unter ihnen Hölderlin, Schleiermacher, Novalis und Hegel. Ab 1732 besucht der junge Kant das Collegium Fridericianum, an dem er eine humanistische Bildung mit Schwerpunkt auf den Altsprachen genießt. 1740 folgte der Beginn des Studiums. Kant studiert laut den meisten Quellen zu Beginn vor allem Naturwissenschaften, die Naturphilosophie und elementare Mathematik.
Es lohnt sich, festzustellen, dass Kant den Großteil seines philosophischen Systems in den letzten 20 Jahren seines Lebens fertigstellte. Obwohl bereits 1746 die Erstveröffentlichung einer Streitschrift zur Mechanik gelang, wurde Kant in den ersten Jahren seines intellektuellen Lebens keine große Aufmerksamkeit zuteil. Der Tod des Vaters im gleichen Jahr zwang Kant dazu, für seinen eigenen Lebensunterhalt sowie den seiner Schwestern aufzukommen. Er verließ die Königsberger Universität und arbeitete von 1746 bis 1754 als Hauslehrer bei drei unterschiedlichen Familien im Umland von Königsberg. 1754 ermöglichte ein Generationenwechsel an der Universität die Rückkehr. In kurzer Folge konnte Kant mit einer „kurzen Skizze einiger Meditationen über das Feuer“ promovieren sowie mehrere Aufsätze über Astronomie, Metaphysik und Geologie veröffentlichen. Es folgte eine rege Tätigkeit als Privatdozent, während derer er Vorlesungen in fast allen Disziplinen hielt und regelmäßig kleinere Texte veröffentlichte. Von 1766 – 1772 hatte er seine erste offizielle Stelle als Unterbibliothekar der königlichen Schlossbibliothek. 1770 folgte dann endlich der Ruf als Professor für Logik und Metaphysik.
Um diese Zeit tritt zum ersten Mal eine geistige Wende Kants auf. War er bis in die späten 1760er Jahre noch den vorherrschenden Lehrmeinungen der Frühaufklärer Leibniz und Wolff gefolgt, die einen starken Optimismus gegenüber den Fähigkeiten der menschlichen Vernunft annahmen, kritisierte er diesen Ansatz stark in seinem satirischen Werk „Träume eines Geistersehers“, in dem er u.a. den Spiritualismus von Emanuel Swedenborg karikiert. Die Idee, die sich hier zeigt, und im Folgenden bei Kant immer wieder zu Vorschein kommt, ist dass der menschliche Geist sich nicht anmaßen darf, Mutmaßungen über Dinge anzustellen, die außerhalb jeder Möglichkeit der Vergewisserung liegen. Kant wendet sich nun stärker dem englischen Empirismus zu, bis er schließlich, 1770, in „De Mundi Sensibilis Atque Intelligibilis Forma et Principiis“ zum ersten Mal die für ihn folgenreiche Unterscheidung zwischen Phaenomena und Noumena trifft. Er möchte damit den Raum der tatsächlichen Phänomene, in dem der menschliche Geist bedeutungshafte und wissenschaftliche Aussagen treffen kann, von dem Raum der Noumena trennen, über deren Inhalt der Mensch lediglich spekulieren, nie aber Gewissheit erlangen kann. Zu letzterer Sphäre gehören unter anderem die Gedanken von der Seele und von Gott. Mit diesem Wandel wird oft die sogenannte „vorkritische“ Periode für beendet erklärt. Die kritische Periode – der Systembau Kants – beginnt.
Ungefähr 10 Jahre lang soll Kant an seinem Hauptwerk, der Kritik der reinen Vernunft (KrV) gearbeitet haben. In ihr setzt er sich insbesondere damit auseinander, was die reine Vernunft – also eine, die sich rein auf Noumena, also abstrakte Erkenntnis, fokussiert – überhaupt leisten kann. Die erste Version der KrV erscheint 1781. 1783 folgen die Prolegomena, eine Art Einführung die kantische Vernunftkritik, 1785 die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, die erste Brücke, die Kant zur Ethik schlägt, 1786 die Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft, die erste Brücke, die Kant von seinem neuen System aus zu den Naturwissenschaften baut. Im gleichen Jahr wird Kant zum Rektor der Universität Königsberg ernannt. 1787 wird er in die Berliner Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Er hat mittlerweile Fehler in seinem eigenen System gefunden und bringt zeitgleich eine zweite, überarbeitete Version der KrV raus. Es folgen 1788 die Kritik der praktischen Vernunft (KpV), die erste komplette Ausarbeitung der Kantischen Moraltheorie, sowie 1790 die Kritik der Urteilskraft, die erste Ausgestaltung einer Theorie der Ästhetik, mit der Kant die KrV und die KpV verbinden will. te Ausarbeitung der Kantischen Moraltheorie, sowie 1790 die Kritik der Urteilskraft, die erste Ausgestaltung einer Theorie der Ästhetik, mit der Kant die KrV und die KpV verbinden will.
Nach 1790 folgen weitere, vor allem kleinere Werke, die auf der nunmehr vollendeten Philosophie aufbauen. In ihr behandelt er vor allem weiterhin Ethik, aber auch Recht, Anthropologie, Geschichtswissenschaft und Theologie. 1796 endet seine Lehrtätigkeit in Königsberg. Hier stirbt Kant 1804. Zur Zeit seines Todes war Kant der am meisten respektierte Philosoph im deutschen Sprachraum. Der Zeitgenosse Moses Mendelssohn nannte ihn für seine Philosophie den „Alleszermalmer“. Warum? Was war an der kantischen Denkweise so besonders?
Eine Revolution der Denkungsart
Die geistige Situation in der Zeit vor Kant war geprägt von dem Widerstreit zweier konkurrierender Schulen, die sich aus der Frühaufklärung heraus entwickelt hatten. Die Frage, wie sicheres Wissen über die Welt zu erwerben ist, hatte sich zu Beginn der Neuzeit durch eine Wiederentdeckung antiker Autoren in den Vordergrund des europäischen Denkens geschoben. Fragen über die Grundlagen der menschlichen Freiheit, der Moral und der politischen Ordnung schienen nur durch eine grundlegende Klärung des Verhältnisses vom menschlichen Geist zur Wirklichkeit beantwortet werden zu können. Konnte der Mensch keine Gewissheit über die Ordnung der Außenwelt erlangen, so schien es, konnten auch keine Fragen zu seiner moralischen oder politischen Ordnung geklärt werden. Zwei Methoden zur Klärung der Gewissheit hatten sich durchgesetzt. Eine, ausgehend von Bacon, Hobbes, Locke und anderen englischen Empiristen, erklärte, dass nur Sinneserfahrung und Beobachtung menschliches Wissen über die Welt begründen können. Eine andere, ausgehend von Descartes und Leibniz, gründete Gewissheit von der Welt und sich selbst allein auf das denkende (Selbst-)Bewusstsein und machte sicheres Wissen in mathematischen und logischen Sätzen aus, die a priori, also ohne Zuhilfenahme von Beobachtung oder Eindrücken von der Welt zu erschließen sind. Die Pattsituation zwischen Empiristen und Rationalisten wurde dadurch verstärkt, dass sich in den schnell entwickelnden Naturwissenschaften grundsätzlich eine Tendenz abzeichnete, die Methode des Empirismus, aber die Gewissheitsdefinition des Rationalismus zu etablieren. Die Namen der Schulen selbst sind hierbei teilweise irreführend: die Schule um Leibniz und Descartes wurde teilweise auch als „idealistisch“ oder als „dogmatisch“ tituliert. Der Widerspruch zwischen den Theorien offenbarte sich im Werk des Empiristen David Hume, der mit einem radikalen Skeptizismus spielte. Für ihn waren jegliche Informationen, mentale Begriffe und Vorstellungen nur direkt aus der sinnlichen Wahrnehmung ableitbar. Die einzige Operation des Geistes aber, mit der wir überhaupt sichere Erkenntnisse gewinnen könnten, ist das kausale Denken. Hume argumentierte allerdings, dass nach streng empiristischen Kriterien keinerlei Kausalität in der Natur nachgewiesen werden: wir nehmen stets nur Bewegungen war, nie aber kausale Zusammenhänge an sich. Kausalität ist bei Hume also nur eine Verdichtung früherer Sinneseindrücke – und keine Gewissheit, die a priori vorausgesetzt werden kann. Nahm man diesen empiristischen Einwand ernst, führte dies zu der paradoxen Situation, dass selbst Rationalisten, die nur dem Geist vertrauten, das Verständnis kausaler Zusammenhänge entweder blind postulieren oder ebenfalls einem Skeptizismus verfallen mussten. Denn wenn all unsere geistigen Begriffe nur aus Sinnesdaten abgeleitete Wahrnehmungen sind, könnten sich unsere Ideen eventuell sogar noch nicht einmal mehr auf reale Objekte beziehen. Bei Hume zerbricht so die fragile Verknüpfung zwischen dem Subjekt und der Außenwelt endgültig und führt zu einer Vernunft, die an allem zweifeln muss – sogar an sich selbst.
Kant schreibt von sich selbst, dass die Lektüre von Hume „ihn aus dem dogmatischen Schlummer der abstrakten Leibnitz’schen Gewissheit gerissen hätte.“ Die große Leistung von seinem philosophischen Projekt besteht nun darin, dass er Humes Kritik der Kausalität zum Anlass genommen hat, zu zeigen, dass auch ohne direkte sinnliche Anschauung die reine Vernunft objektives Wissen generieren kann. Seine Idee ist, dass synthetische Sätze – also Sätze, die zwei unterschiedliche Dinge logisch verbinden, und die man bis dahin nur der empirischen Methode anvertraut hatte – auch a priori, also ganz ohne Sinneswahrnehmung möglich sind. Diese Beweisführung des synthetischen Satzes a priori leistet er anhand einer neuen Definition des synthetischen Satzes in der Mathematik. Gleichzeitig zeigt er auf, dass die reine Vernunft auf Grenzen stößt, wenn sie nicht über empirisches Datenmaterial verfügt – und dass deswegen nicht sinnvolle inhaltliche Behauptungen über Noumena wie die Unsterblichkeit der Seele oder die Existenz Gottes gemacht werden können. Damit richtet er sich gegen Descartes, der mithilfe abstrakten Denkens a priori eine Gewissheit in der Metaphysik annahm.
Mit dieser zweifachen Attacke gegen den Empirismus auf der einen, und gegen den Rationalismus auf der anderen Seite sind wir im Kern dessen, was Kant Vernunftkritik genannt hat. Was Kant in seinen drei Kritiken versucht, ist, eine möglichst akkurate Beschreibung des menschlichen Denkens selbst zu geben. Durch diese Kritik dessen, was die Vernunft leisten – aber auch nicht leisten kann – soll herausgefunden werden, in welchen Bereichen wir Gewissheit erlangen und objektive Gesetzmäßigkeiten finden können – und in welchen nicht. So rührt auch der Name „Transzendentalphilosophie“ daher, dass diese Bestimmung der Grenzbereiche der Vernunft selbst zu einem transzendentalen, das heißt die Vernunftkräfte übersteigenden, Akt wird. Diese Grenzbereiche zu finden, wird bei Kant zum letzten legitimierbaren Betätigungsfeld der Metaphysik. Er stellt die Thesen auf, dass die Vernunft drei Noumena wenigstens annehmen muss: die Freiheit der eigenen Person, die Seele und die Existenz Gottes. Auf diese Weise kann er schlussendlich auch eine überzeugende Theorie der Moral präsentieren.
Wie in Fragen der Erkenntnis zeichnete sich die Zeit vor Kant auch in Fragen der Ethik durch eine grundlegende Debatte darüber aus, was die Grundlagen moralischer Verpflichtung sein können. Rigorose Empiristen wie Thomas Hobbes, die sich den menschlichen Geist wie eine von Impulsen gesteuerte Maschine vorstellen, hatten keine andere Möglichkeit für die Grundlage von Gesetzen gesehen als einen allmächtigen Staat, der durch seine Macht die Menschen von gegenseitigen Konflikten abhält und so Frieden und Sicherheit des Einzelnen garantiert. Andere Denker wie Adam Smith hatten gegen diesen Pessimismus protestiert und darauf gepocht, dass der Mensch durchaus so etwas wie angeborene Moralempfindungen besitzt, auf die sich auch vertrauen ließe. Wie in seiner Erkenntnistheorie benutzt Kant auch in der Ethik seine Vernunftkritik, um Grenzen und Grundlagen des moralischen Verhaltens zu vermessen. Er argumentiert, dass echte Moralität nur einer Achtung vor dem moralischen Gesetz entspringen kann – dass sie also nicht nur moralische Neigungen, einen allmächtigen Staat oder instrumentelle Klugheit erfordert, sondern Pflichtgefühl. Auch hier synthetisiert Kant also durch die Zurückweisung der geläufigen Theorien die Begriffssysteme seiner Zeit. Weiterhin bringt er vor, dass Pflichtgefühl nur aus Achtung vor absolut notwendigen (kategorischen) Gesetzen entstehen kann. Absolut notwendig sind nur Gesetze, deren Notwendigkeit jedes Vernunftwesen aus sich heraus einsehen kann. Universal für jeden einsehbar, laut Kant, ist der Gedanke, dass man seine eigene Freiheit schützen möchte. Achtung vor dem Gesetz setzt also den Gedanken des freien Willens voraus. Durch seine Vernunftkritik kann Kant nun zeigen, dass die menschliche Vernunft ihre eigene Freiheit als Noumenon notwendigerweise annehmen muss, um das Verhalten der Menschen phänomenal zu erklären. Kant würde also behaupten, dass uns die Überzeugung eines freien Willens unwiderruflich geistig einprogrammiert ist. Dies macht er zu der Vorrausetzung des Gedankens, dass jeder Mensch notwendigerweise jeden anderen Menschen so behandeln muss, als sei dieser ein Selbstzweck, als besäße er Freiheit und Würde. Das kategorische Gesetz der Moral besagt also, dass jedes vernünftige Wesen „so handeln muss, als ob es durch seine Maximen jederzeit ein gesetzgebendes Glied im allgemeinen Reiche der Zwecke wäre“ – das heißt, dass jeder Mensch annehmen muss, durch seine Handlungen sich selbst die Gesetze zu geben, nach denen alle vernünftigen und freien Wesen für alle Zeiten handeln sollen.
Dieser „kategorische Imperativ“ ist eine enorm starke Begründung gesetzlicher und moralischer Normativität – er kann plausibel machen, dass wir uns jedes menschliche Verhalten wie einen hypothetischen Vertrag vorzustellen haben, der universal ausbuchstabiert, wie freie Menschen handeln sollen. Was viele allgemein an der Kantischen Denkweise fasziniert hat, ist, dass bei Kant aus einer Untersuchung des menschlichen Denkens tatsächlich Wissen folgt, dass wir als objektiv betrachten können und dass uns Richtlinien für wissenschaftliche, moralische und politische Fragen an die Hand gibt. Bei Kant sind auf einmal die Erkenntnisse von Physik, Mathematik und Logik über jeden Zweifel erhaben. Aber auch die menschlichen Moralgesetze können mit ähnlicher Exaktheit „aus der Vernunft heraus“ bestimmt werden.
In dieser „Selbst-Setzung von Verbindlichkeiten“ kann die große Revolution der neuzeitlichen Denkungsart ausgemacht werden. In der Kantischen, universalistischen Ethik werden moralische Begründungen von Umwelt und Geschichte entkoppelt und rechtfertigen sich durch den Verweis auf ihre Eigengesetzlichkeit alleine. Die Kantische Philosophie bestärkt, als soziale Konsequenz, die zentrale Stellung des Einzelnen in der Erfassung und Gestaltung der Welt. Nicht ein abstraktes metaphysisches Prinzip ist mehr das Zentrum der Welt – sondern der Mensch selbst.
Das Kantische Erbe
Die Idee der Selbstbestimmung des Einzelnen ist mit Sicherheit die größte Hinterlassenschaft, die Kant in die Ideengeschichte eingeschrieben hat. Sie existierte auch schon vorher, aber Kant hat durch seine Vernunftkritik einen Weg gefunden, sie ohne Verweis auf eine andere Instanz zu begründen. Daneben ist eine weitere Nachwirkung des Kantischen Erbes die Idee, dass es abstrakte Gesetze gibt, die wir finden und beachten müssen. Daraus folgt auch, dass keine andere Instanz diese Gesetze missachten darf. Fortschritt ist nichts, was durch Paternalisierung, Bevormundung oder „In-die-richtige-Richtung-Schubsen“ von irgendwem erzwungen werden kann, sondern etwas, das sich von selbst einstellt, wenn der oder die Einzelne Einsicht in die Vernunftgesetze bekommt. Eine dritte Eigenart des Kantischen Denkens hat sich auf diese Art und Weise auch in unsere alltäglichen Argumentationsmuster eingeschlichen: der Selbstzweck. Die Idee, dass der Einzelne, die Moral, die Bildung, der Fortschritt oder: der Mensch sich selbst als Ziel genug ist, und kein Instrument oder Zweck zu irgendeinem übergeordneten Ziel ist, ist in vielen Kontexten auch in den Alltagsdiskurs eingewandert.
Diese drei Säulen: Selbstbestimmung des Einzelnen, die Herrschaft einer abstrakten Rechtsordnung und der Selbstzweck des Menschen in sich, sind sicherlich Teil einer genuin liberalen Weltanschauung. Sie sind dies aber auf einer so fundamentalen Ebene, dass die Frage, ob sie ausschließlich zur Begründung liberaler Thesen benutzt werden können, verneint werden muss. Kants Fokus auf die Emanzipation des Subjekts, auf Vernunftprinzipien und auf die Bekämpfung unbegründeter (Un-)Gewissheiten sind zu einem Grundbestandteil modernen Denkens geworden, an dem alle Weltanschauungen ihre Argumente schärfen können.
Leseempfehlungen
Zur Einführung:
Grondin, Jean (2013): Immanuel Kant zur Einführung. 5., korrigierte Auflage. Hamburg: Junius Verlag.
Scruton, Roger (2001): Kant: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Zu Aspekten kantischer Philosophie:
https://plato.stanford.edu/entries/kant-development/
https://plato.stanford.edu/entries/kant-moral/
https://plato.stanford.edu/entries/kant-social-political/
Sowie zur Idee der „Grenzbestimmung der Vernunft“:
Zill, Rüdiger (2011): Grenze. In: Ralf Konersmann (Hg.): Wörterbuch der philosophischen Metaphern. 3., erw. Aufl. Darmstadt: Wiss. Buchges, S. 138–149
Sowie zu zwei unterschiedlichen (Miss-)Interpretationen Kants:
Als Motor des Nationalismus im 19. Jahrhundert:
Kedourie, Elie (1966): Nationalism. 3. ed. London: Hutchinson (Hutchinson university library).
Und als Argument für totalitaristische Pflichterfüllung:
Arendt, Hannah; Mommsen, Hans (2011): Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen. Erweiterte Taschenbuchausgabe. Zürich: Piper (Piper, 6478).