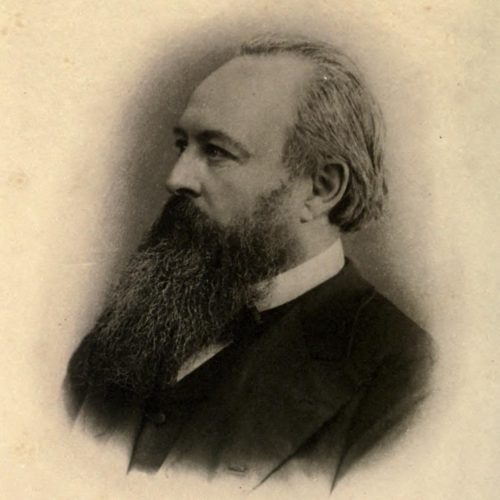Politischer und ethischer Individualismus

Von Timothy Sandefur mit freundlicher Genehmigung von libertarianism.org
Der Individualismus beruht auf der Idee, dass der relevante Bezugspunkt in politischen oder ethischen Fragen der einzelne Mensch ist, nicht die Gesellschaft, die Rasse oder Klasse, das Geschlecht oder eine andere Gruppe. Der Liberalismus ist eine von Grund auf individualistische politische Theorie.
Dem ethischen Individualismus zufolge steht in moralischen Fragen das Individuum und nicht die Gesellschaft als Ganzes im Vordergrund. Moral betrifft in erster Linie das individuelle Wohlergehen und nicht die Interaktionen mit anderen. Zeitgenössische neo-aristotelische Philosophen wie Ayn Rand, Douglas J. Den Uyl und Douglas Rasmussen haben diese Position vertreten. Rand behauptete, dass Moral in erster Linie eine Frage der psychischen Gesundheit sei und dass der Dienst an einer Gruppe kein moralisches Ziel sein könne.
Allerdings sind nicht alle Individualisten auch Egoisten: Platon zum Beispiel lehrt, dass Individuen die ethische Verpflichtung haben, dem Staat bis zum Tod zu dienen — wie Socrates im Kriton. Dennoch ist er der Ansicht, dass der eigentliche Nutznießer moralischer Handlungenen der Einzelne ist, der sich moralisch verhält. In ähnlicher Weise stellt Jesus, obwohl er eine Moral der Selbstaufopferung lehrt, wiederholt fest, dass in den Augen Gottes jedes Individuum wertvoll sei: “Das Reich Gottes ist mitten unter euch.” Andere altruistische Philosophen, einschließlich Kant und Auguste Comte, behaupteten jedoch, dass sich jeder ohne Hintergedanken an den eigenen Vorteil ganz dem Dienst an anderen widmen sollte.
Einige Formen des Protestantismus legten besonderen Wert auf die Rolle des Individuums. Martin Luthers Lehre vom „Priestertum aller Gläubigen” besagt, dass die Geistlichen keine spirituell gesonderte Kategorie Mensch darstellen, sondern dass jede Person durch Jesus eine direkte Beziehung zu Gott habe. So sind alle Menschen vor Gott gleich. Andere protestantische Sekten betonten die religiösen Pflichten und die individuelle Ausrichtung auf die Erlösung.
George Fox, der im 17. Jahrhundert die auch als „Quäker” bekannte Religiöse Gesellschaft der Freunde gründete, argumentierte, dass jedes Individuum von einem „Inneren Licht” geleitet werde, das ihm von Gott eingepflanzt wurde. In der Tat lehrten viele protestantische Glaubensrichtungen die Bedeutung individueller Hingabe, einschließlich des eigenständigen Lesens der Bibel. Auch viele Renaissance-Denker betonten die zentrale Stellung des Individuums. Die Kombination dieser Tendenzen im England des 17. Jahrhunderts trug zur Entstehung des Klassischen Liberalismus bei: Obwohl religiöser Individualismus eine von vielen doktrinären Thematiken war, die zu blutigen Auseinandersetzungen während dieser Zeit führten, unterstützten einige Persönlichkeiten — insbesondere Sir Edward Coke und John Milton — jene politische Philosophien, die weitgehend auf religiösem und säkularem Individualismus beruhten. Coke argumentierte, dass die Garantien der Magna Carta für die „freien Männer” für alle Menschen galten, nicht nur für die Feudalherren, auf die sie sich ursprünglich bezog. Die Regierung bestand für Milton aus Einzelpersonen, die sich entschieden, für die Gesellschaft einzutreten, um die Freiheit zu schützen, die Gott jedem Einzelnen gewährt hatte. Diese frühe Whig-Doktrin wandelte sich später zu dem klassischen Liberalismus der amerikanischen Gründerväter.
Dementsprechend betont der politische Individualismus, dass einzelne Personen, nicht Gruppen über Rechte verfügen, und dass der Staat diese Rechte schützen sollte, statt umgekehrt die Individuen für seine Zwecke zu nutzen. Wie Jefferson schrieb: „Was für alle Mitglieder der Gesellschaft individuell gilt, gilt auch kollektiv für alle zusammen; denn die Rechte des Ganzen können nicht mehr sein als die Summe der Rechte der Einzelnen.” Folglich ist die Regierung analog zu einem Individuum und darf nur so handeln, wie es auch einem Individuum erlaubt wäre; beispielsweise, indem sie das Recht im Namen ihrer Bürger verteidigt. Aus diesem Grund betont der politische Individualismus die individuelle Freiheit, Wahlfreiheit und Selbstbestimmung, während er die Vorstellung von „Verbrechen gegen die Gesellschaft“, also Verbrechen ohne Opfer ablehnt.
Anti-Individualisten oder „Kommunitaristen” kritisieren den Individualismus mit dem Argument, dass es soziale Kräfte seien, die die Identität eines Individuums formen, und dass diese sozialen Identität größere Beachtung verdiene, oder sogar Vorrang vor der individuellen erhalten müsse. John Dewey erklärte die Entdeckung, „dass ein Individuum nichts Fixes, nichts fertig Gegebenes ist, sondern etwas, das verwirklicht wird mithilfe staatlicher, kultureller, wirtschaftlicher, rechtlicher und politischer Institutionen,” die die Regierung bereitstellen müsse, für die Bruchstelle zwischen klassischem und modernem Liberalismus. An diesen Gedanken knüpft Amitai Etzioni an, wenn er den Individualismus als „intellektuell defekt und moralisch irregeleitet” verunglimpft, da dieser verkenne, „dass unser Selbst zu einem erheblichen Teil kulturell und historisch bedingt ist: Wir werden in eine Gemeinschaft und eine Kultur hineingeboren, die uns von Anfang an formt — einschließlich unserer Vorstellungen des Guten und unseres ,auswählenden’ Selbsts.” Allerdings leugnen Individualisten weder den starken Einfluss, den Gemeinschaften auf die Menschen haben, noch bestreiten sie die Bedeutung sozialer Bindungen oder die Vorteile von Gruppen- oder Familienverbänden. Sie sehen diese Konzepte jedoch eher als Güter an, die der Einzelne wählen und als Gut akzeptieren muss, wenn sie einen Wert haben sollen. Kommunitaristen drehen diese Struktur um und betrachten umgekehrt die Gesellschaft als das Kriterium, wonach die Individuen beurteilt sollen. Der Autor Robert Putnam behauptet etwa, dass Netzwerke von Menschen das soziale Kapital schaffen, das für eine gesunde Demokratie notwendig ist, und dass die wachsende „Respektlosigkeit für das öffentliche Leben” der amerikanischen Gesellschaft geschadet habe. Eine solche Vorstellung geht jedoch davon aus, dass die Demokratie oder die Gesellschaft selbst Zwecke oder handelnde Subjekte sind , die Dingen einen Wert beimessen könnten. Doch nur Individuen können den Dingen Wert geben, und wenn so etwas wie ,soziale Interaktionen‘ oder ,Demokratie‘ überhaupt wünschenswerte Gütern sind, dann nur, weil es Individuen gibt, die sie für wünschenswert halten.
Darüber hinaus lehnen Liberale die Vorstellungen ab, dass Individuen lediglich das Produkt der Gesellschaft seien oder dass andere irgendeinen Anspruch auf das Individuum haben könnten, der stärker ist als das recht des Individuums, sich selbst zu bestimmen. Libertäre argumentieren, dass jedes Individuum das grundsätzliche Recht habe, die Kontrolle über seinen Körper und Geist auszuüben — aus drei grundlegenden Gründen: Erstens ist jedes Individuum von Anfang an in ständigem und unumstößlichen Besitz seiner selbst, wobei nichts (außer dem Tod) diese Verbindung zum eigenen Körper und Geist trennen kann. In diesem Sinn ist das Selbsteigentum unveräußerlich.
Zweitens kann niemand der Verantwortung für seine eigenen Handlungen, weder in Bezug auf sich selbst noch auf andere, vollkommen entfliehen. Wenn es jemandem nicht gelingt, sich selbst zu ernähren, dann wird auch diese Person selbst die Konsequenzen tragen. Auch kann niemand anders die Handlungen einer Person bestimmen, außer sie entscheidet sich, den Befehlen eines anderen zu folgen. Niemand kann sich der Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen entziehen: Wenn jemand anderen schadet, wird man ihn (zurecht) dafür zur Rechenschaft ziehen; auch dann, wenn er auf den Befehl eines anderen hin gehandelt hat. Ethischer und politischer Individualismus sind eng verbunden mit der Überzeugung, dass niemand sich seiner Verpflichtungen und Verantwortung ganz entziehen kann.
Drittens, gelten die obigen zwei Gründe für alle Individuen. Dementsprechend hat keine Person ein angeborenes Recht, einen anderen zu beherrschen. In anderen Worten “sind alle Menschen gleich geboren.” Diese drei Beobachtungen gelten für alle Menschen, unabhängig von ihrer Kultur, und sie stützen die Schlussfolgerung, dass jede Person das stärkste Anrecht auf den eigenen Körper und den eigenen Verstand hat. Daher bedarf jeder Versuch, über eine andere Person zu bestimmen, deren vorheriger Zustimmung.
In Anbetracht dessen, dass jeder Einzelne ein unveräußerliches Recht auf sich selbst hat, hängt seine Fähigkeit zur Kooperation mit Anderen davon ab, ein soziales System zu finden, das individuelle Rechte respektiert. Ohne die Bedeutung von Gemeinschaften zu leugnen, legt der Individualismus den Grundstein für die Schaffung von Gemeinschaften, welche wirklich auf die Bedürfnisse der Individuen eingehen, aus denen sie bestehen, ohne dabei ihre Individualität zu bedrohen, die das gesellschaftliche Leben erst wünschenswert macht.
Diese Grundlage für eine Gemeinschaft entsteht durch Achtung der individuellen Rechte und des Konsensprinzips. Dadurch, dass eine liberale Gesellschaft Menschen die Teilnahme in sozialen Gruppen gestattet, aber nicht erzwingt, sind die Einzelnen motivierter, ihre Netzwerke gedeihen zu lassen. Wie David Conway bemerkt hat, könnte eine liberale Gesellschaft „fähig sein, ihren Mitgliedern mehr Entwicklungsmöglichkeiten für das Erleben von Gemeinschaft zu eröfffnen, als jede andere Gesellschaft.”
Im Gegensatz dazu behandeln kollektivistische Systeme ihre Mitglieder als austauschbare Teile des sozialen Organismus, deren Zustimmung irrelevant und deren Rechte von der ,Gesellschaft als Ganzes‘ erteilt und auch wieder zurückgenommen werden können. Daher tendieren freiwillige soziale Netze in kollektivistischen Gesellschaften dazu, weniger stark zu sein als in freien Ländern.
Eine häufige Kritik am Individualismus ist ebenfalls, dass dieser die Grundlagen der Tugend schwäche. So behauptet etwa Alisdair MacIntyre, dass der Individualismus lehre, die Menschen sollen ihre persönliche Zufriedenheit über das Streben nach moralischer Vortrefflichkeit stellen. Liberale leugnen die Möglichkeit unmoralischer und selbstgefälliger Entscheidungen der Individuen nicht, offerieren jedoch zwei Entgegnungen: Erstens muss jede Tugend, um eine Tugend zu sein, von dem betreffenden Individuum bewusst gewählt werden. Eine Handlung, die nicht bewusst ausgeführt wurde, ist kein ethisches Gut: Um ein ethisches Gut zu werden, muss es von einer Person als solches angesehen werden. Wozu auch immer eine Person gezwungen wird — selbst wenn es zu etwas führt, dass diese Person befürworten sollte — hat keinen Wert für diese Person, wenn sie nicht vom Wert dieser Handlung überzeugt ist. Zweitens werden alle politischen Systeme von fehlbaren Menschen geleitet, die ebenso irrationale Ziele verfolgen können wie andere Bürger. Wie Thomas Jefferson sagte: „Manchmal heißt es, man könne dem Menschen nicht die Herrschaft über sich selbst anvertrauen. Aber kann man ihm dann die Herrschaft über andere anvertrauen? Oder haben wir Engel in Gestalt von Königen, um zu herrschen?
Die Begrenzung der Macht des Staates wird die Bürger nicht zu guten Menschen machen. Doch es wird die Tugendhaften vor denen schützen, die nicht moralisch handeln, sowie vor Politikern, die mindestens genauso anfällig dafür sind, in moralischen Fragen zu irren oder möglicherweise eher ihr eigenes Wohlergehen anstreben als das der Bürger.
Der Individualismus ist ein wichtiger Teil der amerikanischen Kultur, nicht aufgrund des protestantischen Erbes, sondern auch wegen der ,frontier experience‘, den Erfahrungen im Zuge der amerikanischen Grenzerweiterung. Als die Pioniere nach Westen zogen, wurden viele anti-individualistische soziale Tabus nach und nach fallen gelassen: überwiegend, weil die Menschen, konfrontiert mit einer feindlichen Umgebung und ohne die relative Sicherheit der urbanen Institutionen, diese Tradition als Verschwendung von Zeit und Mühe ansahen. So wandelte sich die Wahrnehmung der Frau: von dem zerbrechlichen, tugendhaften viktorianischen Geschöpf hin zur starken, autarken Frau. In dieser Zeit wuchsen Eigeninitiative und kritisches Denken zu amerikanischen Tugenden heran. Bis heute ist der Cowboy ein elementares Symbol des amerikanischen Individualismus.
Während der Nachkriegszeit erlebte der Individualismus eine Wiedergeburt im Zuge der Bürgerrechtsbewegung, die die Bildung sozialer Schichten aufgrund von Rasse oder anderen unabänderlichen Merkmalen abschaffen wollte. In Martin Luther Kings Worten: „Die Menschen sollten hinsichtlich ihres Charakters beurteilt werden.” Aus diesem Grund tendiert die amerikanische Popkultur dazu, außergewöhnliche Individuen für ihre einzigartigen Fähigkeiten und Begabungen zu feiern, nicht Klassen oder Gruppen.
Weiterführende Literatur
Brands, H. W. The Age of Gold. New York: Doubleday, 2002.
Bronowski, J., and Bruce Mazlish. The Western Intellectual Tradition. New York: Harper & Row, 1960.
Conway, David. Classical Liberalism: The Unvanquished Ideal. New York: Saint Martin’s, 1998.
Dewey, John. “The Future of Liberalism.” Journal of Philosophy 32 no. 9 (April 25, 1935): 225–230.
Etzioni, Amitai. “Individualism—within History.” The Hedgehog Review (Spring 2002): 49–56.
Fitzpatrick, Sheila. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. Oxford: Oxford University Press, 1999.
MacIntyre, Alisdair. After Virtue: A Study in Moral Theory. 2nd ed. London: Duckworth, 1985.
Palmer, Tom G. “Myths of Individualism.” Cato Policy Report 28 (September/October 1996).
Peikoff, Leonard. Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand. New York: Meridian, 1991.
Putnam, Robert. Bowling Alone. New York: Simon & Schuster, 2000.