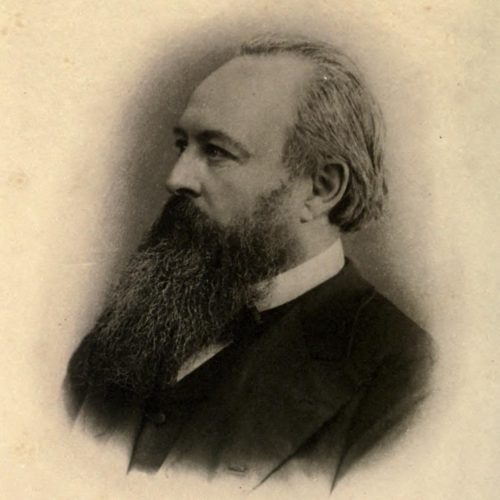Migration

Von Lukas Franzen
Migration – ein Überblick über die theoretische Debatte
Die globale Migration führt dazu, dass die liberalen Demokratien im Wesentlichen zwei Fragen beantworten müssen: Wer darf kommen und wer darf ein Staatsbürger werden?
Bezüglich der Frage wer aus welchen Gründen kommen darf, besteht für Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention bei liberalen Theoretikern im Grunde Einigkeit. Rechtsstaaten haben die Pflicht, diese Menschen aufzunehmen und angemessen zu versorgen. Ein Großteil der migrationswilligen Menschen fällt allerdings nicht in diese Kategorie und aus einer liberalen Perspektive existieren unterschiedliche Konzepte, wie mit dieser Herausforderung umgegangen werden sollte – wobei „Open Borders“ aktuell eine der prominentesten Ideen bei liberalen Denkern darstellt.
Zudem stellt die globale Migration die traditionell exklusiven legitimatorischen Konzepte für Staatsbürgerschaft „ius sanguini“ und „ius soli“ in Frage. Viele Menschen möchten Staatsbürger in einem Land werden, in dem weder sie noch ihre Eltern geboren wurden. Welches Kriterium wäre aus einer liberalen Perspektive zusätzlich zu traditionellen Auffassungen geeignet, um Staatsbürgerschaft zu konstituieren?
Wer darf kommen?
Seit den 1980er Jahren dominiert die „Open Border“-Position von Joseph Carens den theoretischen Migrationsdiskurs. Carens geht davon aus, dass die momentane Einteilung der Welt mit dem Feudalismus im Mittelalter zu vergleichen ist. Das Leben einer Person wird maßgeblich durch die Geburt in eine reiche oder arme Gesellschaft bestimmt. Als egalitärer Liberaler sieht Carens in offenen Grenzen ein Instrument, um global soziale Gerechtigkeit herzustellen. Armen Menschen sollte es also ohne Restriktionen möglich sein, in reiche Gesellschaften einzuwandern und von diesen zu profitieren.
Das Problem bei Argumenten dieser Art ist jedoch die Empirie: unter Ökonomen ist (Stichwort „Braindrain“) höchst umstritten, ob offene Grenzen tatsächlich zur globalen Gerechtigkeit beitragen würden. Zudem versteht Carens sein Konzept nicht als Empfehlung für politische Akteure, sein Argument ist als Heuristik zu betrachten: „The goal of the open borders argument is to challenge complacency, to make us aware of how routine democratic practices in immigration deny freedom and help to maintain unjust inequality. If I can persuade some people to think more critically about the way the world is organized and about the way it ought to be organized, the open borders argument will have done its job. “
Thomas Christiano vertritt als liberaler Kosmopolit hingegen, dass globale Bewegungsfreiheit intrinsisch wertvoll ist und Personen deshalb idealerweise nicht in dieser beschränkt werden sollten.
Da die Welt aber noch in Nationalstaaten aufgeteilt ist und zumindest die liberalen Rechtsstaaten essentiell für die Verwirklichung einer globalen politischen Gemeinschaft sein werden, warnt Christiano gleichzeitig im nicht idealen politischen Rahmen vor den potentiellen Gefahren einer Massenmigration durch offene Grenzen.
Arash Abizadeh macht darauf aufmerksam, dass die Exklusion von Menschen aus Nationalstaaten eine illegitime Gewalt auf diese ausübt und sie in ihrer Autonomie verletzt. Dadurch wird friedlichen Immigranten die Möglichkeit genommen, ein stabiles Leben für sich und ihre Familien aufzubauen. Durch diese Gewaltausübung auf Immigranten werden demokratische Prinzipien verletzt, da diese universal gelten müssten.
Es ist allerdings fragwürdig, weshalb partikulare demokratische Prinzipien für alle Personen gelten sollten, die aufgrund ihres Verhaltens (illegale Einreise in ein Land) der Gewalt eines Demos ausgesetzt sind, da somit die Volkssouveränität – ein fundamentales Prinzip der Demokratie – verletzt wird.
Ein ideales Contra-Argument zu „Open Borders“ aus einer liberalen Perspektive konstruiert Christoph Wellmann. Nach Wellmann hätte ausgehend von liberalen Prinzipien jeder die Freiheit, sich zu einer Gemeinschaft zusammenzuschließen, deshalb gilt dies auch für politische Gemeinschaften. Daraus folgt, dass Menschen auch andere Menschen aus ihrer politischen Gemeinschaft ausschließen dürfen, da sonst das Freiheitsrecht der „Freedom of Association“ keinen Sinn ergebe. Dies legitimiert die politische Selbstbestimmung und den exklusiven Charakter von Nationen – solange dies von den Bewohnern eines Landes so gewollt wird.
Bei dieser argumentativen Vorgehensweise ist problematisch, dass Nationen nicht vergleichbar mit Gemeinschaften wie Sportvereinen sind, jeder Mensch muss einer Nation angehören. Außerdem wird Wellmann vorgeworfen, dass die moralische Validität einer Mitglieder-/Nichtmitgliederunterscheidung auf einer Petitio Principii beruht. Da diese Unterscheidung erst durch die Idee der „Freedom of Association“ entsteht, ist unklar, ob diese moralisch legitim ist.
Ein nicht ideales Contra-Argument zu „Open Borders“ wird von David Miller vertreten. Miller ist bekannt für seine These eines „liberalen Nationalismus“ – ein sozialphilosophischer Ansatz, bei dem Miller sich darum bemüht, den Liberalismus mit dem Nationalismus zu verknüpfen. Die Notwendigkeit dafür sieht Miller in dem Umstand, dass für die meisten Menschen auf der Welt relationale Beziehungen – insbesondere nationale – moralisch relevant sind. Lediglich in einem partikularen Rahmen, der durch Nationalismus konstituiert ist, lassen sich soziale Gerechtigkeit und politische Selbstbestimmung legitimieren. Deshalb geht Miller davon aus, dass es legitim ist, wenn Nationen Einwanderer aufgrund der kulturellen Kompatibilität aussuchen.
Zumindest für Liberale ist dieser Ansatz jedoch wenig überzeugend. Obwohl Solidarität in liberalen Rechtsstaaten historisch im Wesentlichen durch Nationalismus konstituiert wurde, handelt es sich dabei um ein empirisch-kontingentes Phänomen, was durch die politische Praxis der EU oder den Umgang mit Immigranten insbesondere seit 2015 deutlich wird. Von Libertären wird dieser Ansatz grundsätzlich wegen seiner egalitären Komponente abgelehnt.
Letztlich sind sich aber auch die wenigen libertären Theoretiker uneinig, ob „Open Borders“ ein überzeugendes Konzept darstellt. Zum einen werden Grenzen als Teile von Nationalstaaten abgelehnt, andererseits lässt sich bei der Konstitution von Rechten durch Eigentum leicht erkennen, weshalb „Open Borders“ von einigen kritisiert wird.
Wer sollte Staatsbürger werden?
Diese Frage wird zum Teil in Bezug auf Einwanderung diskutiert – aber auch losgelöst von dieser Debatte ist diese Frage relevant, denn bei der Suche nach Kriterien für die Staatsbürgerschaft in einem liberalen Rechtsstaat gilt es herauszufinden, welche Kriterien für die Stabilität eines liberalen Rechtsstaats verantwortlich sind.
Carens bietet in diesem Kontext eine ähnliche Antwort zu seiner „Open Border“-Position an. Der einzige Faktor, den Carens als relevant für die Staatsbürgerschaft erkennen kann, ist die Zeit, die man in einer Gesellschaft verbracht hat. Nach einer gewissen Zeit sollte jede Person die Staatsbürgerschaft der politischen Gemeinschaft, in der sie lebt, annehmen können.
Rainer Bauböck betont mit seinem „Stakeholder“-Prinzip, dass Menschen den Anspruch auf eine Staatsbürgerschaft haben, die ein Interesse an der Zukunft der politischen Gemeinschaft haben. Nach diesem Modell wären multiple Staatsbürgerschaften möglich, zudem ist dieses Konzept gut mit der Identifikation mit einer supranationalen Gemeinschaft wie der EU kompatibel.
Mit dem Verfassungspatriotismus hat Jürgen Habermas hingegen ein Modell konzipiert, das von der politischen Einstellung der potentiellen Staatsbürger abhängig ist. Demnach müssten Einwanderer Demokraten sein und liberale Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit akzeptieren, um Staatsbürger werden zu können.
Für Miller ist hingegen eine gemeinsame, ausschließlich politische Kultur zu wenig für einen funktionierenden Staat. Deshalb vertritt er nicht nur bezüglich der Einwanderung, sondern auch bezüglich der Frage der Staatsbürgerschaft, die Position von kultureller Kompatibilität.
Andere Theoretiker, die auch eine kulturelle These aus einer liberalen Perspektive vertreten, wie Will Kymlicka, weisen hingegen daraufhin, dass der sozialphilosophische Ansatz kein monokultureller, sondern ein multikultureller sein sollte. Aus einer multikulturellen Perspektive lassen sich allerdings kaum Kriterien für die Staatsbürgerschaft ausfindig machen – deshalb wird von Kymlicka auf die politische Praxis von Kanada hingewiesen, das trotz seiner Diversität ein funktionierender liberaler Rechtsstaat ist.
Libertäre, Kosmopoliten und Diskursethiker vertreten hingegen theoretische Konzepte, die unabhängig von einer nationalen Staatsbürgerschaft sind und deshalb losgelöst von der Frage „wer sollte Staatsbürger werden?“ betrachtet werden müssen.