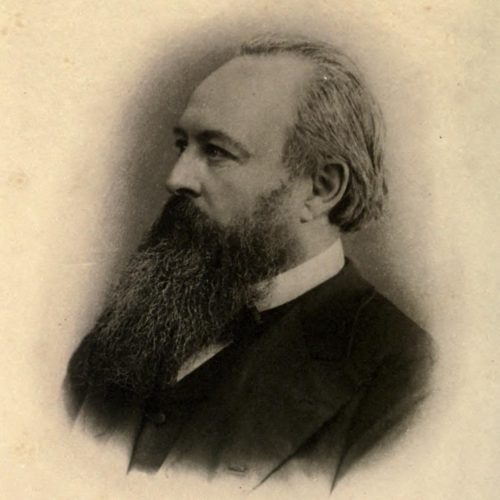Erkenntnistheorie

Von Maximilian Priebe
Erkenntnistheorie? Epistemologie?
Die Erkenntnistheorie ist eine zentrale philosophische Disziplin der Gegenwart. Wie ihr Name andeuten lässt, orientiert sie sich an der Frage, was Erkenntnis ist, und wie diese zustande kommt. Dieser große Gegenstandsbereich wird auch an ihren anderen Namen sichtbar: Im Englischen firmiert sie oft als Theory of Knowledge, oder, allgemeiner, als Epistemology, weswegen im Deutschen Erkenntnistheorie synonym mit Epistemologie gebraucht wird. Das Wort leitet sich vom griechischen Begriff der Epistemē ab, das gemeinhin mit „Wissenschaft“, aber auch „Erkenntnis“ oder schlichtweg „Wissen“ übersetzt wird (vgl. Wolf 2017, 412). Klassische Verwendung erfährt es bei Platon: eine Epistemē bedeutet dort eine gut begründete, wissenschaftliche Position, die sich auf universale Wahrheiten bezieht, im Unterschied zur Doxa, der bloßen wechselnden Meinung. Im platonischen Verständnis ist es das Projekt der Philosophie, Epistemē zu generieren, und den Bereich bloßer Meinungsurteile zu bekämpfen. Im modernen Verständnis hat die Bedeutung sich allerdings durchaus gewandelt. Bei Foucault beispielsweise bezeichnet eine epistème eine grundlegende soziale Ordnungsstruktur, die erst gegeben sein muss, damit eine Sache als Objekt einer Wissenschaft denkbar ist: in der Botanik beispielsweise die Idee, dass Pflanzen anhand von bestimmten Merkmalen klassifizierbar sind (vgl. Foucault 1974, 24–25 und Sarasin 2012, 99). Es zeigt sich also in den verschiedenen Versuchen, das Wort zu bestimmen, bereits der Anspruch unterschiedlicher philosophischer Ansätze, eine wissenschaftliche Bestimmung von Wissen zu geben, sowie zu erklären, wie man am Besten zu diesem Wissen kommt. Dabei genügt „epistemisch“ als Leerstelle, um klarzustellen, dass sich eine Problematik um einen Wissensbegriff oder um die Generierung von Wissen dreht. So reden wir beispielsweise von „epistemischen Zugängen“ oder sagen, ein Problem habe eine „epistemische Dimension“, wenn ein Wissensbegriff, mit dem wir operieren, unklar ist, oder wir nicht wissen, auf welche Weise genau unser Wissen zustande kommt – zum Beispiel bei moralischen oder politischen Urteilen.
Aufgrund ihrer Fragestellung ist die Erkenntnistheorie mit vielen Fachbereichen der theoretischen Gegenwartsphilosophie verwandt: mit der Metaphysik über die Frage nach der fundamentalen Struktur der Wirklichkeit, mit der Wissenschaftstheorie über die Frage danach, was gute Wissenschaft ausmacht, mit der Philosophie des Geistes über die Frage danach, wie Denken und Bewusstsein funktionieren, mit der Sprachphilosophie und der Naturphilosophie über die Frage, was über die Realität ausgesagt werden kann. Aber auch die praktische Philosophie kommt nicht ohne eine Positionierung zu epistemologischen Fragestellungen aus: eine Ethik, die nicht sagen kann, wie man die Richtigkeit moralischer Handlungen erkennt, oder eine Sozialphilosophie, die nicht sagen kann, was an der Gesellschaft wissenschaftlich erfassbar ist, wären zu nicht viel Nütze. Diese Beobachtung sollte zeigen, dass die Erkenntnistheorie im Zentrum der Philosophie, aber auch an der Basis vieler Einzelwissenschaften liegt. Sie liefert die theoretischen Grundbausteine, mit denen die jeweiligen Wissenschaften ihren Erkenntnisanspruch und ihre Methodik festlegen. Das epistemische Fundament der Wirtschaftswissenschaften ist beispielsweise ein anderes als das, mit dem die Kulturwissenschaft arbeitet. Da Erkenntnisanspruch und Methodik der Wissenschaften aber nicht in Stein gemeißelt sind, bleibt auch die Epistemologie als Grundsatzdisziplin und Gesprächspartner relevant. Im Folgenden werde ich die wesentlichen epistemologischen Problemfelder vorstellen und anschließend mit der Frage enden, ob es eine „liberale“ Erkenntnistheorie gibt.
Abgrenzungen und Grundströmungen
Innerhalb der derzeitigen erkenntnistheoretischen Debatte gibt es verschiedene Hauptfragen und zu diesen Hauptfragen gibt es unterschiedliche Positionen, die sich in der Tradition unterschiedlicher historischer Vorgänger sehen. Eine Hauptfrage ist, was Wissen ist. Eine andere Hauptfrage ist, wie Wissen entsteht. Eine weitere Hauptfrage ist, was wir überhaupt wissen können. Sodann gibt es weitere Fragen, wie die, welchen Wert Wissen überhaupt hat, ob Wissen ewig gültig sein kann, welche verschiedenen Arten von Wissen es gibt, ob ein Wissen besser sein kann als ein anderes, etc. Auf die ersten zwei Hauptfragen möchte ich kurz eingehen.
- Was ist Wissen?
1.1 Eine Standarddefinition von Wissen besagt, dass Wissen begründete, wahre Überzeugung ist. Sie wurde innerhalb des platonischen Dialogs Theatetus aufgestellt (Theatetus, 202c) und dort am Ende verworfen. Obwohl die Standarddefinition in den 1960ern anhand mehrerer Fallbeispiele erfolgreich ad absurdum geführt werden konnte (vgl. Gettier 1963) wird sie weiterhin als Daumenregel verwendet – auch, weil sich bis heute keine praktikablere Definition fand. Die drei Teile der Definition werden separat und unter Rückbezug auf die normalsprachliche Verwendung des Wortes „Wissen“ begründet: Wir sprechen nicht von Wissen, wenn wir an selbiges Wissen nicht glauben. Deswegen muss Wissen Überzeugung implizieren. Es kann auch nicht als Wissen gelten, wenn es schlichtweg nicht der Fall ist. Deswegen muss Wissen wahr sein. Es kann aber auch nicht als Wissen gelten, wenn wir für das Wissen keine Gründe anführen können. Deswegen muss Wissen begründet sein. Alles, was nicht in diese drei Kategorien fällt, kann Glaube, Wunsch oder Arbeitshypothese sein, aber kein Wissen.
Es leiten sich aus der Definition entscheidende Fragen ab, die von der Erkenntnistheorie bearbeitet werden: ab wann ist eine Begründung begründet genug? Und: woher wissen wir, wann ein Satz wahr ist? Erstere Frage betrifft die Beurteilung von Argumenten und führt direkt in die epistemologische Debatte. Die zweite Frage betrifft die Theorie der Wahrheit. Es ist wichtig, Wahrheitstheorien von Wissenstheorien zu trennen. Denn die Frage, was als „Wahrheit“ gelten darf, hat neben der epistemischen Ebene auch eine formale Dimension, die für die Mathematik und die Logik relevant ist. So würden in einem strikt semantischen Sinn nur jene Sätze als wahr gelten, die logisch eine Tautologie sind. Unter dieser Definition würden aber eine Vielzahl von Sätzen, die wir zu wissen beanspruchen, aus dem Wahrheitskriterium herausfallen (beispielsweise, dass jeder Mensch einen Körper hat, dass der Abendstern der Morgenstern ist, etc.) Um dies zu vermeiden, wird als Standardtheorie der Wahrheit meist die sogenannte Korrespondenztheorie genannt. Sie besagt, dass ein Satz wahr ist, wenn das, was er aussagt, in der Welt der Fall ist, in anderen Worten: wenn Gegenstand und Erkenntnisgegenstand zur Übereinstimmung kommen. Die erkenntnistheoretische Korrespondenztheorie geht normalerweise mit Theorien des Bewusstseins einher, die mentalen Repräsentationalismus annehmen, also die Vorstellung, dass mentale Zustände Sachverhalte der externen Welt abbilden oder wiederspiegeln, und dass eine solche mentale Repräsentation nur dann richtig ist, wenn sie mit der externen Welt korrespondiert, d.h. sie richtig abbildet, sowie mit einem (metaphysischen) Externalismus, der besagt, dass die Welt unabhängig von uns so ist, wie sie ist, und wir uns über sie auch irren können.
Natürlich haben auch diese Theorien ihre jeweiligen Probleme. Woher, beispielsweise, weiß ich, dass es eine geistesunabhängige, sich nicht verändernde Welt gibt, wenn alles, was ich über die Welt weiß, von meinem Geist abhängig ist? Die Korrespondenztheorie der Wahrheit wird auch gerade in der Erkenntnistheorie der Sozialwissenschaften problematisch, in der das beobachtende Subjekt (als Teil der Gesellschaft) stets schon Teil des Objektes (der Gesellschaft) ist, mit dem eine Korrespondenz hergestellt werden soll, und in der überhaupt fraglich ist, ob eine Gesellschaft überhaupt deskriptiv neutral „wiedergespiegelt“ werden kann – da sich das, was gespiegelt werden soll, beständig ändert. In diesen Fällen wird meist auf andere Wahrheitstheorien zurückgegriffen – wie beispielsweise auf die Konsenstheorie von Jürgen Habermas, die Wahrheit als Resultat gelingender Diskurse unter spezifischen Bedingungen auffasst. Es kann auch der objektive Wissensanspruch komplett aufgegeben und etwa in eine „Theorie des Verstehens“ umgewandelt werden, wie sie Gadamer mit seiner Hermeneutik vorgelegt hat. Hier treten Beobachter und beobachtetes Objekt in ein Dialogverhältnis, an dessen Ende sowohl Betrachter wie Betrachtetes sich verändert und aneinander angenähert haben.
1.2 Die Position, dass es wirkliches Wissen nicht gibt und dass, alles, was wir zu wissen glauben, in Wahrheit eine Meinung ist, die von unserer Kultur, Bildung oder unserer anthropologischen Disposition abhängt, heißt Relativismus. Diese Position lässt sich u.a. zurückführen auf den Sophisten Protagoras, der darauf aufmerksam machte, dass es nur das Maß des Menschen ist, das bestimmt, welche Dinge wir als existent annehmen und welche nicht.. Die Folgerung: andere, die andere Maße benutzen, könnten zu wesentlich anderen und genauso gerechtfertigten Bildern von der Welt kommen, und deswegen ist unser Wissen nicht gerechtfertigter als jede andere Behauptung auch. Die meisten Epistemologen haben ein Problem mit dem Relativismus, weil ein starker Relativismus sowohl das Projekt der Wissenschaft als auch die Idee einer universellen Moral, zum Beispiel der Menschenrechte, unterminiert. Die gegensätzliche Meinung zum Relativismus heißt Realismus, die wiederum Hand in Hand geht mit oben genannter Korrespondenztheorie und dem Externalismus. Epistemologische Realisten müssen eine objektiv gestaltete Welt annehmen, mit der das menschliche Streben nach Wahrheit zur Übereinstimmung kommen kann, sodass sich Urteile über sie in wahr und falsch unterscheiden lassen. Ein gutes Argument gegen den Relativismus ist performativ: Wenn Relativismus wahr wäre, müssten die Meinungen des Realisten genauso wahr sein wie die des Relativisten. Realismus und Relativismus wären dann gleichzeitig der Fall. Im Sinne des Realismus ist es aber, keinen Relativismus zuzulassen. Wenn der Realismus wahr ist, muss der Relativismus also falsch sein. Der Relativismus kann also nicht gleichzeitig wahr sein und der Fall sein. Die Popularität des Relativismus sollte sich demnach auf ein Missverständnis zurückführen lassen. Denn viele, die der Meinung sind, dass es „das wahre Wissen“ nicht gibt, vertreten meist einen falsch verstandenen Skeptizismus. Dieser behauptet lediglich, dass es uns nicht möglich ist, in unserem Leben an sicheres Wissen zu gelangen, sondern dass wir uns mit anderen Lösungen zufriedengeben müssen. Dies führt zum zweiten Punkt.
- Wie gelangen wir zu Wissen?
In der Ideengeschichte gibt es eine Reihe von Grundposition, auf die die gegenwärtigen Debatten gerne zurückgreifen. Allerdings hängen diese historischen Grundpositionen auch durchaus mit den unterschiedlichen Arten von Wissen zusammen, an die gedacht wird, wenn sein Ursprung zu erklären versucht wird.
2.1 Eine der historisch einflussreichsten Positionen wurde von Platon entwickelt. Sie besagt, dass sich wirkliches Wissen auf unveränderliche, universale Wahrheiten bezieht. Diese Wahrheiten – die Ideen, oder Formen – sind realer als die sich stetig verändernde Welt, die wir im täglichen Leben wahrnehmen. Sie strukturieren diese Realität sogar. Wir haben erst dann Wissen von einer Sache, wenn wir die ihr zugrunde liegende Form erkannt haben. Dabei ist die Erkenntnis von den Formen keine Aufnahme von neuen Informationen. Im Gegenteil: Platons Lehre besagt, dass wir das Wissen von den Formen bereits in uns tragen, und diese im Lernprozess introspektiv freilegen. Lernen und Erkennen sind eine Form der Wiedererinnerung (Anamnese). Die Art von Wissen, an die Platon hier denkt, betrifft vor allem die Geometrie und die Arithmetik. Seine Argumente stützen sich auf Fälle, in denen Menschen ohne Vorbildung durch reine Betätigung des Geistes in die Lage versetzt werden, mathematische Probleme zu lösen. In dem Sinne sollte man sich die platonischen Formen als unveränderliche Proportionen und Harmonien vorstellen, die der Realität und uns selbst unterliegen und im Prozess der Wissenschaft (wieder-)entdeckt werden. Die platonische Lehre war von mit ihrer Betonung des Geistes und der Vernunft von großer Bedeutung für die Entwicklung des westlichen Denkens. Sie prägte die antike Mathematik, die Theologie des Frühmittelalters und wurde in der Neuzeit durch Mathematiker wie Descartes und Leibniz aufgegriffen, die mithilfe reiner Kontemplation metaphysische Gewissheiten suchten, auf denen sie das Projekt der neuzeitlichen Wissenschaft gründen wollten. Dies führte unter anderem zum bis heute prägenden Geist-Körper Dualismus, der besagt, dass der Mensch sich in einen denkenden und einen körperlichen Teil aufteilt, sich allerdings nur des denkenden Teils intuitiv bewusst sein kann und deswegen durch seine mentalen Zustände als Mensch definiert ist, und nicht durch seinen Körper. Positionen, die die Rolle der Vernunft bzw. des Geistes im Erlangen von Wissen und in der Struktur der Realität stark machen, werden meist Idealismus oder Rationalismus genannt, wobei die genaue Bedeutung dieser Bezeichnungen oft je nach Forschungsdebatte variiert.
2.2 Die Gegenposition zu Platon geht ebenfalls bis in die Antike zurück und wurde von Aristoteles entwickelt. Aristoteles war der Meinung, dass begründetes Wissen nicht nur aus kontemplativer Vernunft entsteht, sondern auch durch das Studium und die Auswertung von Datenmaterial. Neben der (platonischen) theoretischen Lehre befasste er sich deswegen auch mit Botanik, Zoologie, Biologie, Physik und anderen Erfahrungswissenschaften. Er war einer der ersten, die die Natur systematisch klassifizierten. Im Unterschied zu Platon beschreibt Aristoteles in seiner Erkenntnistheorie detailliert die verschiedenen menschlichen Organe und sieht in der Sinneswahrnehmung die Basis menschlichen Wissens von der Welt. Er entwickelte das Bild des menschlichen Geistes als einer „tabula rasa“, eines unbeschriebenen Wachstäfelchens, auf dem die Objekte der Außenwelt ihre Eindrücke hinterlassen. Für ihn sind die Gegenstände der externen Welt je einzigartige Verbindungen von Stoff und Form und besitzen ebenso einzigartige Dispositionen, Qualitäten und Ziele, die vom Menschen studiert werden können. (Man nennt diese Position auch Hylomorphismus.) Auf diese Weise sind nicht nur physikalische Vorhersagen über die Veränderungen der Gegenstände in der Welt möglich, sondern es kann auch erklärt werden, dass Erkenntnis von einer Sache immer dann entsteht, wenn die besonderen Qualitäten eines Objektes menschliche Sinne affizieren. Diese Position, die den Menschen als Empfänger von Daten einer logisch strukturierten Naturwelt sieht, beeinflusste stark die spätmittelalterliche Theologie sowie die neuzeitliche Naturwissenschaft. Moderne Denker wie Francis Bacon, John Locke und Isaac Newton entwickelten diesen Ansatz weiter. Heute ist der Fokus auf Quantifizierung und Vermessung eine Selbstverständlichkeit in vielen Bereichen des Denkens. Die zugrundliegende epistemologische Überzeugung wird unter dem Oberbegriff des Empirismus zusammengefasst.
2.3 Eine dritte einflussreiche Position ist der bereits erwähnte Skeptizismus. Er besagt, dass Wissen über die wahre Natur der Dinge prinzipiell unmöglich ist. Skeptiker sind nicht absolut inkompatibel mit den oben erwähnten Schulen, sondern setzen meist nur den Erkenntnisanspruch der jeweiligen Methodik herab, ohne diese im Ganzen zu verwerfen. Der Skeptizismus formierte sich als eigenständige, konsistente Position gegen Ende der Antike und spielte auch eine große Rolle dabei, der Unüberprüfbarkeit der christlichen Lehre Glaubwürdigkeit zu verleihen. Er lässt sich nicht auf einen Denker zurückführen, sondern wurde von verschiedenen Philosophen unterschiedlich gelehrt. Eine der kohärentesten Zusammenfassung skeptischer Positionen wurde von Sextus Empiricus vorgelegt. Sein Skeptizismus argumentiert zweigleisig. Ein Argument dafür, dass sicheres Wissen unmöglich ist, ist rein formal, und bezieht sich auf die oben erwähnte Standarddefinition von Wissen. Das zweite Argument ist eine Weiterentwicklung der empiristischen Position. Das formale Argument greift die Begründungsnotwendigkeit von Wissen an. Es behauptet, dass Wissen kategorisch nicht begründbar ist. Dies wird mit folgendem Trilemma gezeigt: Wenn ich meine, dass ich x weiß, kann ich immer gefragt werden, warum ich x weiß. X muss (der Standarddefinition von Wissen zufolge) begründet sein. Ich muss also eine Begründung y annehmen. Jetzt kann wieder gefragt werden, warum ich y weiß. Y muss aber ebenfalls begründet sein, also ich muss ich z annehmen, etc. Es zeichnen sich drei Möglichkeiten ab: Entweder ist die Begründung nie einholbar. Das ist die erste Option, nämlich die des infiniten Regresses. Oder ich setze als Begründung für y das zu beweisende Wissen x. Das ist die zweite Option, nämlich die des Zirkelschlusses. Oder ich setze als Begründung für y den Satz z einfach ohne Begründung als erste Grundannahme fest. Das ist die dritte Option, nämlich die der dogmatischen Annahme. Die Skeptiker weisen alle drei Optionen als nicht adäquat zurück. Für sie ist Wissen schlichtweg nie hinreichend begründbar. Ihr zweites Argument betrifft die Erkenntnisquelle. Skeptiker erkennen an, dass es so etwas wie Wahrnehmungen gibt, also Phänomene wie Gefühle, Empfindungen, Hunger, Durst, Überzeugungen, Ideen. Sie verneinen diese Phänomene nicht, weil sie dafür wieder eine negative Gewissheit bräuchten. Allerdings gestehen sie den Phänomenen auch nicht zu, dass sie irgendeinen Rückschluss darauf zulassen, wie die Realität an sich ist. Ihr empirischer Zugang zur Welt ist also keine sichere Erkenntnisquelle, und deswegen auch im Sinne einer radikalen Skepsis nicht geeignet, ein Fundament für irgendeine Art von Wissenschaft zu sein. Der Skeptizismus hatte großen Einfluss auf die europäische Neuzeit. Ihr Fokus auf die Phänomene beeinflusste die Phänomenologie Franz Brentanos und Edmund Husserls (vgl.Hossenfelder 1993, 59-61); eine ähnliche Sichtweise vertrat auch David Hume mit seinem Sensualismus. Heute gehört der Skeptizismus in seiner moderaten Form selbstverständlich zur Wissenschaftspraxis, in dem Sinne, als dass Wissenschaft meist nicht mehr als ein metaphysisches Projekt zur Aufdeckung der Struktur der Wirklichkeit verstanden wird, sondern als soziale Praxis, die zwar mit großer Treffsicherheit und auf der Grundlage von beobachteten Korrelationen Prognosen und Analysen produziert, aber immer auch irrtumsanfällig ist und keine Letztbegründung liefert.
2.4 Dieses Verständnis von Wissenschaft hängt auch mit der letzten der großen epistemologischen Grundströmungen zusammen: den Kantischen bzw. Nachkantischen Erkenntnistheorien. Immanuel Kants originelle Erkenntnistheorie entstand aus dem Versuch, den Skeptizismus zu überwinden. Er teilte die Welt in zwei Sphären ein: eine, die potentiell erfahrbar ist (die phänomenale), und eine, die nie erfahrbar ist (die noumenale). Er behauptet, dass die Struktur der phänomenalen Welt mit der Struktur unseres Geistes im Sinne der Korrespondenztheorie übereinstimmen kann, wohingegen die noumenale Welt nur abstrakt gedacht werden kann. Obwohl alle wirklichen Interessensgegenstände der Erkenntnistheorie in der noumenalen Welt liegen, richtet sich unsere Erkenntnis, sowohl sinnlich als auch geistig, stets nur auf die Phänomene. Die Pointe ist nun, dass in der phänomenalen Welt die Gesetze, die der menschliche Verstand entdeckt, mit Objektivität gelten. Die Wissenschaft, obwohl sie stets nur im phänomenalen Rahmen operiert, ist dadurch keiner Skepsis ausgeliefert. Denn die Denkmittel, mit denen sie vorgeht – sowohl in empiristischer, also auch in rationalistischer Hinsicht – sind durch die Vernunftgesetze, die auch die Naturgesetze selbst sind, abgesichert. Die Noumena hingegen (beispielsweise die Fragen, ob es eine Seele oder einen Gott gibt) übersteigen die Kapazitäten der menschlichen Vernunft und müssen mithilfe des Glaubens als der phänomenalen Welt zugrunde liegende Fundamente angenommen werden. Aufgrund dieser transzendentalen („die Erfahrungswelt übersteigenden“) Grenze, die Kant dem Idealismus Platons und Leibniz‘ setzt, wird seine Theorie auch transzendentaler Idealismus genannt. Sein Fokus auf die Rolle der menschlichen Vernunft in der Absicherung der objektiven Naturgesetze verlagerte den Fokus der Erkenntnistheorie von der Außenwelt in die Innenwelt des Subjekts. In der Nachfolge Kants entstanden deswegen eine Reihe wichtiger Erkenntnistheorien, die die Erkenntnis stärker als eine aktive Tätigkeit des Subjekts verstehen und weniger als eine passive Anpassung an eine bereits vorstrukturierte Realität. In dieser Linie sind u.a. der amerikanische Pragmatismus zu nennen, der Erkenntnis als das Festsetzen einer Meinung sieht, die in zukünftiger wissenschaftlicher und sozialer Praxis als Handlungsdisposition dienen kann. In der gleichen Linie steht der Positivismus, der als Kriterium der Erkenntnis die empirische bzw. logische Nachprüfbarkeit eines Satzes nennt, sowie der Kritische Rationalismus Karl Poppers, der das Kriterium der Verifikation eintauscht gegen das Kriterium der Falsifizierung. Laut Popper ist es das Projekt der Wissenschaft, bestehende Sätze nicht zu belegen, sondern an deren Widerlegung zu arbeiten, sowie weiterhin solche Sätze aufzustellen, die wiederum potentiell falsifiziert werden können. Unter dieser Perspektive ist Erkenntnis und Wissen erneut von der Ebene der Wahrheit und der Objektivität entkoppelt, und ein rein instrumentelles Vorgehen, mit dem sich der Mensch auf seine Umgebung einlässt, ohne sich auf eine einzige Erkenntnisquelle zu beschränken. Ob sich unter solchen Umständen eine Kantische Objektivität in der phänomenalen Welt noch annehmen lässt, oder selbst als eine unbegründete und potentiell nicht falsifizierbare These verworfen werden muss, ist wiederum eine Frage zeitgenössischer Erkenntnistheorie.
III. Gibt es eine liberale Erkenntnistheorie?
Historisch ist die politische Weltanschauung des Liberalismus mit der Weltsicht des Empirismus und des Skeptizismus verknüpft. Dies liegt auch daran, dass wichtige Vordenker des Liberalismus in politischen Fragen – wie John Locke, Adam Smith oder David Hume – in wissenschaftlichen Fragen dem Empirismus nahestanden, der mit seinen quantitativen Ansätzen auch eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften spielte. Gleichzeitig hielt eine grundsätzlich skeptische Grundhaltung Denker wie Hume oder Popper davon ab, ihre Erkenntnisse zu einer absoluten Letztgewissheit zu erheben. Dazu legt der der liberale Gedanke, dass der oder die Einzelne eine wichtige Rolle bei der Weltgestaltung spielt und spielen sollte, auch nahe, dass das Gleiche für die Welterkenntnis gilt. In dieser Überzeugung, dass jeder Mensch ein vernunftbegabtes, kognitives Wesen ist, dass sich Zusammenhänge ohne fremde Hilfe oder Bevormundung erschließen kann, zeigt sich der Einfluss Kants. Ein Kennzeichen für den Liberalismus ist insgesamt die Idee, dass die Welt nicht vorstrukturiert ist. Sie ist kein „fertiges Resultat“, das statisch ist und mithilfe einer richtigen Lehrmeinung wiedergespiegelt werden kann. Stattdessen ist sie unabgeschlossen und potentiell durch den Einzelnen erkenn- und veränderbar. Auch Wissen ist also nicht hermetisch abgeriegelt, kein geheimer Besitz und nur durch Zufall oder besondere Lehren erreichbar, sondern ein frei verfügbares, dynamisches und unabgeschlossenes Produkt menschlicher Neugierde und Aktivität. Ob diese Idee an sich eine gute Idee ist, oder nur die notwendige Vorannahme einer politischen Gesinnung, ist an sich wieder eine erkenntnistheoretische Frage.
Literatur
Pritchard, Duncan (2013): What is this thing called knowledge? Third edition. London, New York: Routledge Taylor & Francis Group (What is this thing called?).
Schnädelbach, Herbert (2008): Erkenntnistheorie zur Einführung. 3. erg. Aufl. Hamburg: Junius (Zur Einführung).
Verwendete Literatur:
Wolf, Ursula (2017): Register der griechischen Termini. In Ursula Wolf (Ed.): Aristoteles. Metaphysik. Übersetzt von Hermann Bonitz. 4. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt (rororo, 55544 : Rowohlts Enzyklopädie), pp. 411–414.
Hossenfelder, Malte (1993): Einleitung. In Malte Hossenfelder (Ed.): Sextus Empiricus. Grundriß der pyrrhonischen Skepsis. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft), pp. 9–90.
Sarasin, Philipp (2012): Michel Foucault zur Einführung. 5., vollständig überarb. Auflage. Hamburg: Junius Verlag.
Foucault, Michel (1974): Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 96).
Plato; Benardete, Seth (2006): The being of the beautiful. Plato’s Theaetetus, Sophist, and Statesman / Plato ; translated by Seth Benardete. Chicago, Ill.: University of Chicago Press; [Bristol: University Presses Marketing.]